Anfang November 2009 wird entschieden, ob die Opfer von Postelberg eine Gedenktafel bekommen
Auf der Sitzung am 22. Oktober 2009 lag den Postelberger Stadtverordneten eine Dokumentation über die Verbrechen in Postelberg im Mai/ Juni 1945 vor, die der „Förderverein der Stadt Saaz|Žatec“ auf CD zusammengestellt hatte. Sie begründete den Antrag von Otokar Löbl, eine Gedenkstätte für die Opfer dieses Massakers zu errichten, für den sich dann auch die Denkmalkommission der Stadt ausgesprochen hat.
Die Sitzung wurde um 17 Uhr eröffnet. PhDr. Michal Pehr begründete die Entscheidung der Kommission, Otokar Löbl wurde anschließend noch nach Details befragt. Es folgte eine hitzige Diskussion, die im Beschluss endete, innerhalb von 14 Tagen in einer außerordentlichen Sitzung darüber endgültig zu entscheiden.
Anschließend fand im Restaurant „Flamingo“ eine Pressekonferenz des „Fördervereins“ statt, an der Rundfunk, Fernsehen und 13 Journalisten aus der Tschechischen Republik teilnahmen. Alle Teilnehmer erhielten die Dokumentationsmappe. Die Veranstaltung wurde in allen tschechischen Medien ausführlich kommentiert.
- Otokar Löbl, Michal Pehr
Tschechien und Deutschland im gemeinsamen Europa
Von Otokar Löbl | Festrede zur 15-jährigen Städtepartnerschaft zwischen Bad Hersfeld und Šumperk|Mährisch Schönberg in Bad Hersfeld, 10. Oktober 2009
Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Gäste,
 es ist für mich eine große Ehre, anlässlich des 15-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft zwischen Bad Hersfeld und Šumperk (deutsch Mährisch Schönberg) über das Thema „Tschechien und Deutschland im gemeinsamen Europa“ zu sprechen. Dies gibt mir die Gelegenheit, Ihnen meine Ansichten über die deutsch-tschechischen Beziehungen und ihre Bedeutung für Europa darzulegen.
es ist für mich eine große Ehre, anlässlich des 15-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft zwischen Bad Hersfeld und Šumperk (deutsch Mährisch Schönberg) über das Thema „Tschechien und Deutschland im gemeinsamen Europa“ zu sprechen. Dies gibt mir die Gelegenheit, Ihnen meine Ansichten über die deutsch-tschechischen Beziehungen und ihre Bedeutung für Europa darzulegen.
Doch erlauben sie mir zuerst, mich Ihnen vorzustellen: Ich bin nach den Krieg, 1950, in der Stadt Žatec, auf deutsch Saaz, in Nordböhmen geboren. Damals waren Tschechen und Slowaken noch in der Tschechoslowakei vereint. Ich bin der Sohn deutschsprachiger Eltern, einer katholischen Mutter und eines jüdischen Vater. Die Angehörigen meines Vaters sind während der deutschen Besatzung Böhmens alle, bis auf meine Großmutter, im KZ umgekommen. Die Großmutter überlebte im Ghetto Theresienstadt, starb aber vor meiner Geburt. Mein Vater überlebte den Krieg nur Dank hoher Tapferkeitsauszeichnungen im 1. Weltkrieg. Die Geschwister meiner Mutter wurden nach dem Krieg von den Tschechen aus dem Egerland vertrieben. Mein Vater durfte als Jude zusammen mit meiner Mutter in der Heimatstadt Saaz bleiben.
Während des „Prager Frühlings“ 1968 war ich als Jugendlicher politisch sehr aktiv. Nach der gewaltsamen Unterdrückung dieser Bewegung durch sowjetische Panzer sah ich für mich unter dem kommunistischen Regime keine Zukunft mehr. 1970 gelang es mir, in Rahmen einer Familienzusammenführung legal in die Bundesrepublik auszureisen. Seit den 90er Jahre bemühe ich mich als Mitglied deutscher und tschechischer Vereine um eine Verständigung der beiden Nachbarn in Europa. Dazu soll der „Saazer Weg“ dienen, der die Versöhnung zwischen Tschechen und der Schicksalsgemeinschaft der Heimatvertriebenen auf dem Wege von Wahrheit und Vergebung vorsieht und einen zukunftsorientierten und demokratischen Dialog anstrebt, ohne sturem Beharren auf Rechtsstandpunkten und einseitigen Schuldbekenntnissen.
Seit 2003 wird dieses generationenübergreifendes Projekt vor allem vom „Förderverein der Stadt Saaz“ vertreten, dessen Vorsitzender ich bin, in enger Zusammenarbeit mit dem tschechischen Partnerverein „Landsleute und Freunde der Stadt Žatec (Saaz)“ und dem Heimatkreis Saaz in Roth. Erlauben Sie mir, aus dem „Saazer Weg“ zu zitieren:
Der Saazer Weg ist der Versuch, sich von der Vergangenheit und ihren schrecklichen Ereignissen nicht gefangen nehmen zu lassen, sondern der gemeinsamen Zukunft von Tschechen und Deutschen im europäischen Haus eine Zukunft zu geben. Die den Saazer Weg gehen wollen, sind überzeugt: Ohne Erinnerung kann es keine Versöhnung geben, aber ewige Vorwürfe führen auch nicht zum Ziel. Die Freundschaft, die heute Deutsche mit Franzosen und Polen verbindet, muss auch zwischen Tschechen und Deutschen möglich sein.
Dies ist aus der aktuellen Version von 2003 in der Formulierung unseres Schriftführers, des Historikers Dr. Kalckhoff, der freundlicherweise auch diese Rede hier durchgesehen hat.
Bei meinen Bemühungen um das deutsch-tschechische Verhältnis lasse ich mich von dem Gießener Philosophen Odo Marquardt und dessen skeptischem, aber aufgeklärten Konservatismus leiten: Weil wir als Zeitgeborene immer schon eine Welt vorfinden, über die wir nicht frei verfügen können – vielmehr anknüpfen müssen an Vorhandenes im negativen wie im positiven Sinne –, ist unser Handeln stärker durch Traditionen und Gewohnheiten als durch Neuanfänge und Veränderungen bestimmt. Dies trifft selbst dann noch zu, wenn wie in der Moderne eine allgemeine Wandlungsbeschleunigung der Lebensverhältnisse stattfindet. „Zukunft braucht Herkunft“, und wenn Herkunft schwindet, finden sich Mittel und Wege, ihren Verlust zu ersetzen oder auszugleichen. Dies ist nicht nur für die deutsch-tschechischen Beziehungen von Bedeutung, sondern für den ganzen Integrationsprozess und die Zukunft der Völker in Europa. Dies bedeutet, dass die Völker im gemeinsamen Europa nicht ihre Identität, ihre Traditionen und Wurzeln verlieren dürfen.
Böhmen besteht seit mehr als tausend Jahren. Dank seiner Lage im Zentrum des europäischen Kontinents spielte es im Laufe der Geschichte als Königreich und Sitz mehrerer deutscher Kaiser eine bedeutende Rolle. Seine Geschichte ist zutiefst europäische Geschichte. In ihr spiegeln sich die Probleme der gesamteuropäischen Geschichte, im Positiven wie im Negativen. Man denke nur an die Bedeutung von Prag und Saaz für die europäische Bildungsgeschichte, den Frühhumanismus und die Frühreformation, aber auch an die düsteren Aspekte der Hussitenkriege und die kriegsauslösende Rolle Böhmens im Dreißigjährigen Krieges.
Böhmen war Teil des Habsburger Reichs und wurde bei dessen Umwandlung in die Österreichisch-Ungarische Monarchie dem Teilreich Österreich zugeschlagen. Damit war der nachfolgende Konflikt vorprogrammiert. Gab es früher Auseinandersetzungen um die Religion, so war das Verhältnis zwischen Tschechen und Deutschen im 19. Jahrhundert vom Sprachenstreit bestimmt. Die Amtssprache in Böhmen war Deutsch. Mit wachsendem tschechischen Nationalbewusstsein wurde dies zum Ärgernis für die slawische Mehrheit in Böhmen.
Während die Österreicher die tschechische Sprachmehrheit bis zum Ende der Donaumonarchie nicht gesetzlich respektierten, wurden die Deutschen nach dem 1. Weltkrieg in der Tschechoslowakei zu einer geduldeten Minderheit. Der Sprachenstreit setzte sich fort, jetzt unter umgekehrtem Vorzeichen. Während vor dem Krieg die Tschechen aus Enttäuschung über ihre nationale Zurücksetzung nach Unabhängigkeit riefen, taten es jetzt die Deutschen. Diese separatistischen Tendenzen hatten aber mehrere Ursachen. Ich nenne hier nur die Wirtschaftskrise und die Arbeitslosigkeit, * Bemerkung* Aufstieg des Nationalsozialismus in Deutschland und der radikale Versuch der Regierung in Prag, ohne Rücksicht auf die vorhandenen und gefestigten Strukturen auch in dem Teil Böhmens, der von überwiegend Deutschen bewohnt war , einen zentralen tschechoslowakischen Staat aufzubauen. Dies alles führte 1938 zum Münchner Abkommen, das einer Kastrierung der böhmischen Länder gleichkam – einer Lösung, die sich später rächte. Hitlers Besetzung des Restes der Tschechoslowakei im Jahr darauf mit der Gründung des Protektorates Böhmen und Mähren und eines slowakischen faschistischen Satellitenstaates war das Ende der kurzen Selbständigkeit. (Der Beginn der Tragödie und eines Trauma für die Tschechen)
Die anschließenden Verbrechen der deutschen Nationalsozialisten – Lidice, Ležáky, Malín, sowie die Ermordung der Juden – belasten die deutsch-tschechischen Beziehung bis in die heutige Zeit schwer. Dabei erschien das Protektorat lange als eine Oase inmitten des europaweiten Kriegs und wirkte kaum wie ein besetztes Land. Denn die Verhaftungen, Folterungen, Hinrichtungen und Verschleppungen in Arbeitslager wurden in aller Heimlichkeit durchgeführt. Da die gut ausgebildeten tschechischen Arbeiter für die deutsche Rüstungsindustrie von großer Wichtigkeit waren, durfte kein Aufsehen erregt werden. Ziel der Liquidierungen war die Intelligenz des Landes, waren Studenten und bürgerlicher Mittelstand, die für den Nazistaat nutzlos und gefährlich zugleich waren.
Dieses System der Heimlichkeit wurde nach dem Krieg von der tschechischen Nationalfront unter Leitung der Kommunisten weitergeführt. Die ethnischen Säuberungen an den Deutschen, die Massaker an ihnen und ihre Vertreibung aus den angestammten Wohngebieten, die von den Siegermächten in Potsdam nachträglich gebilligt wurde, wurden vertuscht oder verharmlost und den Nachgeborenen in ihrem wahren Ausmaß verheimlicht. Gleichzeitig waren sie eine Generalprobe für das, was die Tschechische Republik in den nächsten fünfzig Jahren erwartete. Die Abrechnung mit dem „Klassenfeind“, mit dem alten westlich orientierten Bürgertum, und der Versuch, eine neue „proletarische“ Intelligenz zu schaffen, waren die ersten Schritte. Die Deutschen aber, die Jahrhunderte lang zusammen mit den Tschechen das Land Böhmen kultiviert hatten, wurden zu Ausländern, zu denen man kaum mehr Kontakt hatte, weder zu den Westdeutschen, noch zu den „sozialistischen Brüdern“ in der DDR.
Auch in Deutschland nahm man 1945, die „Stunde Null“, zum Anlass für einen Neuanfang, doch auf ganz andere Weise. Die bürgerliche Gesellschaft, die von den Nationalsozialisten zerstört worden war, wurde wieder aufgebaut, Deutschland zurückgeführt in die Gemeinschaft freier Völker.
Dieses Deutschland (BRD) stellte sich der Schuld des Dritten Reichs und empfand Scham über seine Kriegsverbrechen, wenn auch manchmal nur zögerlich. Acht Millionen Heimatvertriebene, darunter die über zwei Millionen Deutschböhmen, beteiligten sich intensiv am Wiederaufbau. Dieses Jahr feiern wir den 60-jährigen Geburtstag einer freiheitlichen rechtstaatlichen Ordnung, auf die wir sehr stolz sind. Während die Tschechen und Slowaken Gefangene des sowjetischen Panzerkommunismus blieben, konnte sich die Mehrzahl der Deutschen an der Gründung eines freiheitlichen Staatenbunds in Europa beteiligen.
Auch letzteres war dem tschechischen Volk nach der Befreiung von der deutschen nationalsozialistischen Herrschaft nicht vergönnt. Die Enttäuschung über das Verhalten der Westmächte 1938, die Dankbarkeit gegenüber den Russen für die militärische Befreiung und die Begeisterung über die scheinbar wiedergewonnene Freiheit machte viele blind für die Gefahren bolschewistischer Herrschaft. Viele glauben noch heute an das Märchen von einer demokratischen Tschechischen Republik 1945-1948. In Wirklichkeit begann mit dem Kaschauer Programm im April 1945 die Diktatur der sog. „Nationalen Front“ unter der Führung der KPČ. Der „Februar-Umsturz“ 1948 bedeutete nur eine Formalisierung und Zementierung der tatsächlichen Machtverhältnisse. Dass 1945 mit den Deutschen angeblich nur Nazi-Invasoren und hochverräterische Separatisten vertrieben wurden, wurde zur Lebenslüge der tschechoslowakischer Innenpolitik – die nach den traumatischen Besatzungsjahren nur allzu leicht geglaubt wurde. Sie vergiftete indes das Verhältnis zum westdeutschen Nachbarn bis in die jüngste Zeit.
Die Tschechoslowakei zwischen 1948 bis 1989 scheint, bei oberflächlicher Betrachtung, als totalitäres Regime sowjetischer Bauart. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass es immer wieder Phasen relativer Freiheit gab und für kurze Zeit die totalitären Machtmechanismen sogar gelähmt schienen. Die 1960er Jahre waren eine Zeit des zunehmenden Optimismus. Eine breite Front aus Intellektuellen, Schriftstellern und Künstlern, aus KP-Mitgliedern und Parteilosen begann, den Terror der vorgegangenen zehn Jahre als Anomalie wahrzunehmen und eine Liberalisierung der „sozialistischen Gesellschaft“ anzustreben. Im „Prager Frühlings“ 1968 erkämpfte man sich ein beachtliches Maß an Bürgerrechten, Freiräume für autonome Aktionen auf politischem, gesellschaftlichem und kulturellem Gebiet entstanden, der „eiserne Vorhang“ war für kurze Zeit durchlässig. Im Rahmen eines antipluralistischen, undemokratischen und zentralistischen Systems war dies etwas Paradoxes. Der Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes, mit dem das Experiment eines „dritten Weges“ militärisch beendet wurde, erscheint da im Nachhinein nur logisch.
Mit dem Ende der Sowjetmacht 1989 verschaffte sich auch der Freiheitswillen der Tschechen und Slowaken wieder Raum. Wie in der DDR wurde die bolschewistische Parteidiktatur in kurzer Zeit hinweggefegt. Daran erinnern wir uns gerade in diesen Tagen wieder. Ziemlich genau vor 20 Jahren begann in Prag die „samtene Revolution“, die Demokratie, Bürgerrechte, Marktwirtschaft und nationale Selbstbestimmung brachte.
Leider erfüllte sich nicht die deutsche Hoffnung, dass die Verständigung und Versöhnung über die Gräben des Krieges und der Nachkriegsereignisse hinweg mit einem demokratischen Nachbarn ungleich leichter sein würde als mit dem kommunistischen. Die neuen demokratischen Politiker in der Tschechoslowakei – von Ausnahmen abgesehen – waren und sind teilweise noch geprägt von der kommunistischen Geschichtslüge über die im Großen und Ganzen humane und gerechte „Abschiebung“ (odsun) der Deutschen, die ihnen in der Schule aufgetischt wurde. Auf der anderen Seite zeigen sich viele Sudentendeutsche, besonders aber einige – ich betone einige Verbandsfunktionäre der SL – nicht bereit zum Verzicht auf „historische Rechte“ und juristische Ansprüche. Dies spiegelt sich leider auch in der Satzung der SL wieder. Sie wollen nicht den Zusammenhang zwischen nationalsozialistischen Verbrechen und Vertreibung sehen und erkennen nicht, dass auch die Tschechen und Slowaken einen Anspruch auf Entschuldigung für erlittenes Unrecht haben. (Bemerkung: Es wird mit den gleichen konstruierten Kausalitäten argumentiert.)
Die tschechische Presse hat sich neuerdings verstärkt des Themas Vertreibung und Massaker an Deutschen angenommen – angeregt durch Initiativen von Vereinen wie dem unseren, wie ich in aller Bescheidenheit erwähnen darf. Auf der anderen Seite sorgen deutsche Fernsehsendungen und Vereinsinitiativen dafür, dass die Verbrechen der Naziherrschaft in Böhmen nicht in Vergessenheit geraten.
Formell wurden die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Tschechien mittlerweile durch den „Vertrag über gute Nachbarschaft“ von 1992 auf ein stabiles Fundament gestellt. Regelmäßige Treffen auf allen politischen Ebenen, die ausgezeichnete Zusammenarbeit in der EU und in anderen internationalen Organisationen sowie gemeinsame Initiativen in gesellschaftlichen Bereichen haben ein festes Band geschaffen. Ein Zeugnis dafür ist auch diese Veranstaltung anlässlich des 15-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft zwischen Bad Hersfeld und Šumperk.
Aus den zahlreichen Stiftungen, die sich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit verschrieben haben, ist besonders der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds hervorzuheben.
Weiter die Aktivitäten der Ackermann-Gemeinde, die gerade ihr Bundestreffen zum ersten Mal in Tschechien (nämlich in Pilsen) veranstaltet hat, sowie die kulturellen Veranstaltungen des Adalbert-Stifter-Vereins. Auch die Bemühungen von Heimatvertriebenenvereine etwa hinsichtlich der Restaurierung von Kirchen und anderen schützenswerten Bauwerken.
Sicher ist, dass die Völker nur dann ruhig in die Zukunft schauen können, wenn sie auch die dunklen Seiten ihrer Vergangenheit annehmen und die Wahrheit nicht verdrängen. Nur so ist Versöhnung und Vergebung möglich, nur so ruhen die Toten in Frieden, nur so ist die Zukunft wirklich sicher. Nur auf der Grundlage eines gemeinsamen Geschichtsverständnisse lässt sich ein sicheres Haus Europa bauen.
Ich bedanke mich für ihre Aufmerksamkeit.
Publizist Luděk Navara beim „Förderverein“ zu Besuch
Luděk Navara, Redakteur der führenden tschechischen Tageszeitung Mladá fronta DNES besuchte am Samstag, den 8. August 2009, den Förderverein der Stadt Saaz|Žatec in Frankfurt am Main. Als Journalist und Publizist beschäftigt er sich unter anderem mit den Verbrechen des Kommunismus und Nationalsozialismus. Mehrmals berichtete er ausführlich über „Postelberg“ und die Bemühungen des Fördervereins zur Aufklärung der dortigen Ereignisse 1945, insbesondere auch über die Ausstellung „Opfer der kommunistischen Macht in Nordböhmen 1945-1946„. In Frankfurt informierte er sich über die nächsten Vorhaben des Fördervereins und nutzte die verbleibende Zeit zu einer Tour durch Frankfurts Kunst- und Geschichtsmuseen.
 LUDĚK NAVARA ist 1964 in Brünn|Brno geboren, wo er heute auch lebt. Seit 1995 arbeitet er als Redakteur der Tageszeitung überregionalen tschechischen MF Dnes. Nach abgeschlossenem Studium an der Technischen Universität Brünn, absolvierte 1995 er ein Fernstudium der Geschichte an der Philosophischen Fakultät der Masaryk-Universität in Brünn. Er befasste sich u. a. mit den Verbrechen des Nationalsozialismus und des Kommunismus. Als Drehbuchautor arbeitet Navara danach mit dem Tschechischen Fernsehen zusammen:
LUDĚK NAVARA ist 1964 in Brünn|Brno geboren, wo er heute auch lebt. Seit 1995 arbeitet er als Redakteur der Tageszeitung überregionalen tschechischen MF Dnes. Nach abgeschlossenem Studium an der Technischen Universität Brünn, absolvierte 1995 er ein Fernstudium der Geschichte an der Philosophischen Fakultät der Masaryk-Universität in Brünn. Er befasste sich u. a. mit den Verbrechen des Nationalsozialismus und des Kommunismus. Als Drehbuchautor arbeitet Navara danach mit dem Tschechischen Fernsehen zusammen:
- Er ist Mitautor der Vorlage für die Fernsehdokumentation über die Vertreibung der Brünner Deutschen nach dem 2. Weltkrieg („Und der Zug der Deutschen ging …“)
- sowie des Dokumentarfilms über die missglückte Vertreibung deiner deutschen Familie aus Bodenstadt („Die aufgeschobene Abschiebung“).
- Nach seinem Buch „Der Tod heißt Tutter“ (2002, in deutscher Übersetzung 2005), wurde ein Dokumentarfilm gedreht.
- In den Jahren 2004, 2006 und 2007 sind insgesamt drei Teile seines Buchs „Vorfälle am Eisernen Vorhang“ erschienen, die als Vorlage für die gleichnamige 39-teilige Dokumentarfilmserie dienten. Ins Deutsche wurde der erste Teil übersetzt („Vorfälle am Eisernen Vorhang“, 2006).
- 2007 wurde nach seiner Vorlage ein einstündiger Dokumentarfilm über den Flieger der britischen Luftwaffe und späteren Häftling kommunistischer Gefängnisse Josef Bryks gedreht („Ein Mann, der die tschechische Seele überschätze oder Die Fluchtversuche des Josef Bryks)“. Für diesen Film sowie die Vorfälle am Eisernen Vorhang ist er mit Preisen ausgezeichnet worden.
- Gemeinsam mit Miroslav Kasáček gab er das Buch „Die Müller von Babice“ heraus, das die tragischen Ereignisse im mährischen Dorf Babice in den 50er Jahren dokumentiert.
2008 bekam Luděk Navara den Journalistenpreis des Karel Havlíček Borovský.
Verdienten die Deutschen die Vertreibung?
Wissenschaftler und Journalisten diskutierten in Prag vor großem Publikum
Anlässlich der in Prag gastierenden Ausstellung „Die Opfer der kommunistischen Macht in Nordböhmen in den Jahren 1945-1946“ luden die Kuratoren Eduard Vacek und Otokar Löbl am 26. Februar 2009 zu einer Podiumsdiskussion, die der DNES-Redakteur Martin Komárek moderierte. Nicht nur führende tschechische Publizisten und Historiker nahmen daran teil, sondern auch eine Delegation aus Postelberg mit Ratsherren, Stadtverordneten und den Mitgliedern der Denkmalkommission, die sich für die anstehende Entscheidung über eine Gedenkstätte für die Opfer des Postelberger Massakers mit historischen und politischen Einschätzungen versorgen konnten.
 Die Veranstaltung fand im Kulturhaus von Novodvorská, einem Prager Stadtteil statt, wo auch die Ausstellung gezeigt wurde. Auf dem Podium saßen die renommierten Historiker Lukáš Jelínek, Vít Smetana und Adrian von Arburg, der bekannte Politologen Bohumil Doležal, der prominente Journalist Vladimír Kučera, sowie für die Postelberger Denkmalkommission Michal Pehr und für die Ausstellungskuratoren Otokar Löbl. Chefkommentator der namhaften Prager Tageszeitung „Mladá Fronta DNES“, Martin Komárek, moderierte.
Die Veranstaltung fand im Kulturhaus von Novodvorská, einem Prager Stadtteil statt, wo auch die Ausstellung gezeigt wurde. Auf dem Podium saßen die renommierten Historiker Lukáš Jelínek, Vít Smetana und Adrian von Arburg, der bekannte Politologen Bohumil Doležal, der prominente Journalist Vladimír Kučera, sowie für die Postelberger Denkmalkommission Michal Pehr und für die Ausstellungskuratoren Otokar Löbl. Chefkommentator der namhaften Prager Tageszeitung „Mladá Fronta DNES“, Martin Komárek, moderierte.
Das Thema der Diskussion lautete „Die Vertreibung der Deutschen: Vergeltung oder Verbrechen?“ und beschäftigte sich mit folgenden Fragen:
-
Waren die Kommunisten bei der Vertreibung der Deutschen 1945 wirklich schon an der Macht?“
-
Verdienten die Deutschen die Vertreibung durch ihre Haltung im Jahr 1938?
- Wie ist das Bild der Vertreibung in den Medien? Hat es sich veränderte?
- Warum hält die überwältigende Mehrheit der tschechischen Öffentlichkeit die Vertreibung für richtig?
Da gleichzeitig im Foyer des Kulturhauses die umstrittene Ausstellung mit ausdrucksstarken Fotos von den Verbrechen an der deutschen Zivilbevölkerung in Nordböhmen zu sehen war, schlugen die Emotionen hohe Wellen. Das lag auch daran, dass viele Kommunisten, angeführt von der Sprecherin des Zentralkomitees der KPČ, Monika Hoření, und Mitglieder des nationalistischen „Klubs des tschechischen Grenzgebietes“ gekommen waren. Die hitzige Diskussion machte 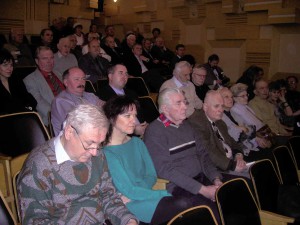 deutlich, mit welchen Voreingenommenheiten, Aversionen und Hassäußerungen man sich heute immer noch in der Tschechischen Republik bei der Aufarbeitung der Vergangenheit auseinandersetzen muss. Eine anschauliche und in die Vorgeschichte der Veranstaltung ausgreifenden Schilderung liefert dazu Adalbert Wollrab vom Heimatkreis Saaz, der ebenfalls nach Prag gereist war.
deutlich, mit welchen Voreingenommenheiten, Aversionen und Hassäußerungen man sich heute immer noch in der Tschechischen Republik bei der Aufarbeitung der Vergangenheit auseinandersetzen muss. Eine anschauliche und in die Vorgeschichte der Veranstaltung ausgreifenden Schilderung liefert dazu Adalbert Wollrab vom Heimatkreis Saaz, der ebenfalls nach Prag gereist war.
Die Aufregung war so groß, dass es zu einer Beschwerde beim Präsidenten Václav Klaus kam. Dieser sah sich zu einem Antwortschreiben genötigt, in dem er die Beschwerdeführer auf die Möglichkeit hinwies, durch eigene Initiativen, Ausstellungen und Diskussionsrunden ihre persönliche Sicht von objektiver Geschichte darzulegen.
- Von Arburg, Smetana
- Von Arburg, Smetana, Komárek, Jelínek
- Smetana, Komárek, Jelínek, Löbl
- Löbl
- Publikum
- Vertreter des Postelberger Stadtrats
Vertreibung der Deutschen: Vergeltung oder Verbrechen?
Eindrücke von einer Ausstellung und einer Podiumsdiskussion in Prag
Von Uta Reiff
 Am 26. Februar 2009 fand auf Initiative des Vorsitzenden des Fördervereins der Stadt Saaz|Žatec in Prag eine Podiumsdiskussion statt., mit dem Thema: „Die Vertreibung der Deutschen: Vergeltung oder Verbrechen?“ Ort der Veranstaltung war das Kulturzentrum Novodvorská, ein großes repräsentatives Haus. Die Diskussion wurde – aus deutscher Sicht leider – ohne Dolmetscher geführt, denn das hätte zuviel gekostet und die finanziellen Mittel des Fördervereins sind begrenzt. So konnte ich mich nicht an der Diskussion beteiligen, da ich Tschechisch zwar verstehe, aber noch nicht gut frei sprechen kann.
Am 26. Februar 2009 fand auf Initiative des Vorsitzenden des Fördervereins der Stadt Saaz|Žatec in Prag eine Podiumsdiskussion statt., mit dem Thema: „Die Vertreibung der Deutschen: Vergeltung oder Verbrechen?“ Ort der Veranstaltung war das Kulturzentrum Novodvorská, ein großes repräsentatives Haus. Die Diskussion wurde – aus deutscher Sicht leider – ohne Dolmetscher geführt, denn das hätte zuviel gekostet und die finanziellen Mittel des Fördervereins sind begrenzt. So konnte ich mich nicht an der Diskussion beteiligen, da ich Tschechisch zwar verstehe, aber noch nicht gut frei sprechen kann.
Es saßen hochkarätige tschechische Historiker und Journalisten auf dem Podium. Moderiert wurde die Diskussion von Martin Komárek, dem Chefredakteur der bekannten Zeitung Mladá Fronta DNES. Die Diskussion war gegliedert in zwei thematische Runden:
- „Waren die Kommunisten wirklich schon an der Macht vor der Vertreibung der Deutschen im Jahr 1945? Verdienten die Deutschen die Vertreibung durch ihre Haltung im Jahr 1938? War der Plan dazu vorbereitet?“
Auf dem Podium saßen außer Komárek: Adrian von Arburg, Tomáš Jelínek und Vít Smetana, drei bekannte tschechische Historiker, und Otokar Löbl.
- „Die Vertreibung der Deutschen in den tschechischen Medien. Wie veränderte sich das Bild der Vertreibung in den Medien und wie ist der gegenwärtige Stand? Warum hält die überwältigende Mehrheit der tschechischen Öffentlichkeit die Vertreibung für richtig?“
Auf dem Podium saßen dazu (außer Komárek): der Historiker und Publizist Michal Pehr und die prominenten Journalisten Bohumil Doležal und Vladimíř Kučera.
Gleichzeitig war im weitläufigen, hellen Foyer des Kulturhauses die Ausstellung „Die Opfer der Kommunistischen Macht in Nordböhmen in den Jahren 1945-1946“ zu sehen. Diese inhaltlich überaus beeindruckende Ausstellung mit dem Untertitel: „War es gerechte Vergeltung, Rache oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit?“ zeigt in sehr ausdrucksstarken Fotos und Dokumenten die Verbrechen an der deutschen Zivilbevölkerung in Nordböhmen. Es werden genau Befehlsstruktur und Befehlswege dargestellt, wodurch ganz klar wird, dass diese Verbrechen, vor allem das Massaker in Postelberg, auf Anweisung aus Prag begangen wurden. Genannt seien hier Brigadegeneral Oldřich Spaniel und General Svoboda. Die Zeugenaussagen von deutschen Bewohnern aus Saaz, die die Gräuel in Postelberg überlebt haben und danach auch noch zu Zwangsarbeit gezwungen wurden, aber auch von Saazer Frauen, vervollständigen diese Dokumentation des Grauens. Die Zeitzeugenaussagen wurden in Georgensgmünd im Sommer 2006 – durch Vermittlung von Otokar Löbl – von Miroslav Bambušek und einem Kameramann aufgenommen. Es sind unschätzbare Quelle!
Nicht zuletzt diese Ausstellung, durch die alle Besucher gehen mussten, bevor sie den Veranstaltungssaal betraten, trug dazu bei, dass die Diskussion sehr emotionsgeladen geführt wurde. Die Historiker auf dem Podium bewerteten die Fakten recht objektiv gemäß ihren geschichtlichen Erkenntnisse, und auch die Journalisten äußerten nach meinem Verständnis eine ziemlich ausgewogene Meinung. Die etwa hundert Besucher jedoch, die wohl zu einem großen Teil aus (Alt-) Kommunisten bestanden, ereiferten sich und verteidigten die Vertreibung der Deutschen. Vor allem wiesen sie darauf hin, was sie an Schlimmem unter der deutschen Besatzung entweder selbst erlebt hatten oder was das tschechische Volk insgesamt erleben musste. Und natürlich wiesen sie auch darauf hin, mit welcher Freude die Sudetendeutschen Hitler und seine Armee willkommen geheißen haben. Die Herren auf dem Podium versuchten immer wieder zu beschwichtigen, allen voran der Moderator Martin Komárek, da aber das Mikrofon ausgefallen war, war mancher Diskussionsteilnehmer kaum zu stoppen.
Einige im Publikum schienen aber doch nachdenklich zu werden aufgrund der Informationen und Meinungen der Historiker und Journalisten auf dem Podium und der drastischen Ausstellung im Foyer, die sie gesehen hatten. Ein Vertreter aus Postelberg äußerte sich positiv zugunsten eines Mahnmals in der Stadt, wurde aber durch laute Zurufe fast ausgebuht. Es war schade, dass nicht mehr jüngere Gruppen oder Teilnehmer gekommen waren, dann hätte das vielleicht ein anderes Bild ergeben. So waren die meisten Besucher verbitterte alte Herren mit grauem Haar, ewig Gestrige.
Zusammenfassend möchte ich sagen, dass Veranstaltungen dieser Art – und vor allem die schockierende Ausstellung – sicherlich dazu beitragen, das Bewusstsein hinsichtlich des Verbrechens und der Unmenschlichkeit der Vertreibung in der tschechischen Bevölkerung wachsen zu lassen. Auch Schulklassen haben diese Dokumentation besucht, und viele Schüler waren entsetzt von diesen schrecklichen Taten. Bei meinen Besuchen in Tschechien – ich wohne nur eine Stunde von der Grenze entfernt – konnte ich doch ein gewisses Umdenken, vor allem in der mittleren und jüngeren Generation, bemerken. Leider durfte ja die Vertreibung und die damit verbundenen Verbrechen an den Sudetendeutschen in der Tschechoslowakei vor 1989 kaum erwähnt werden und wenn, dann in völlig verdrehter Form. Ich war sehr beeindruckt vom Entsetzen in den Gesichtern und den Äußerungen vieler tschechischer Besucher, die von diesen schrecklichen Ereignissen nichts gewusst haben, und denen der odsun („Abschiebung“) oder transfer mit ganz anderem Hintergrund und in ganz anderer, humanerer Form geschildert worden war – wenn überhaupt. Auch meine Unterhaltungen mit Tschechen, wenn ich mich als Deutsche aus dem heutigen Tschechien zu erkennen gebe, werden zunehmend interessanter. Das Thema „Vertreibung“ spielt jetzt eine größere Rolle und stößt auf immer mehr Interesse und Verständnis, zumal wenn ich der heutigen Generation zu verstehen gebe, dass ich ihnen keine Schuld an diesen furchtbaren Ereignisse zuweise – dass aber das tschechische Volk trotzdem die historische Wahrheit über diese unmenschliche Vertreibung wissen sollte.
Wird in Postelberg ein Gedenkstein für die Opfer des Postelberger Massakers stehen?
Von Prof. Dr. Adalbert Wollrab
Die tschechische Öffentlichkeit erfährt von „Postelberg“
Zu den schrecklichsten Ereignissen der Nachkriegsgeschichte zählt mit Sicherheit der Todesmarsch [1] der deutschen männlichen Bevölkerung der Stadt Saaz am 3. Juni 1945 von Saaz nach Postelberg und die Massenmorde in der Postelberger Kaserne, in Postelberg und in der Umgebung von Postelberg. Die Verbrechen in Postelberg wurden an der deutschen Zivilbevölkerung, an unschuldigen Männern, Frauen und sogar Kindern verübt.
Die Zusammenarbeit des damaligen Vorstandes des Kulturkreises Saaz e. V. unter Vorsitz von Prof. Dr. Herbert Voitl mit dem tschechischen Saazer Verein „Vereinigung der Landsleute und Freunde der Stadt Saaz“ (im weiteren benutze ich für diesen Verein die Abkürzung rodáci) ermöglichte es, dass in Saaz am 19. September 2002 eine Gedenkfeier für die Opfer der Postelberger Massaker, auch mit Einverständnis des Saazer Bürgermeisters, abgehalten werden konnte. Um die Dreifaltigkeitssäule [sogenannte „Pestsäule“] am Marktplatz in Saaz versammelten sich die angereisten [Deutsch-] Saazer Teilnehmer der Feier [2], und vor Vertretern der geladenen tschechischen Presse erstattete unser Saazer Landsmann Peter Klepsch einen Erlebnisbericht, den ich simultan in die tschechische Sprache übersetzte. Es folgte eine Fahrt zur Kranzniederlegung im Fasanengarten bei Postelberg und am Nachmittag eine umfangreiche Pressekonferenz im Hotel Motes in Saaz.
Eine breite tschechische Öffentlichkeit erhielt durch die Zeitungsartikel über diese Feier Kenntnis von den Verbrechen in Postelberg, und dies war der Auslöser dafür, dass sich Medien in der Tschechischen Republik eingehend mit dem Postelberger Massaker befassten. [Beträge dazu leisteten auch] die Wanderausstellung „Die Opfer der kommunistischen Macht in dem nordböhmischen Gebiet in den Jahren 1945-1946″, das in [erstmals n Laun und später auch in] Prag aufgeführte Theaterstück „Porta Apostolorum“[4] und die Sendung des tschechischen Fernsehens über die Morde in Postelberg „Auch Morde bewillkommneten den Frieden“). Diese medialen Ereignisse in der Tschechischen Republik rückten die Postelberger Verbrechen in das Bewusstsein der tschechischen Bevölkerung, und dies ebnete die Wege, die – so hoffe ich – in Postelberg zu einem Denkmal für die Opfer der Postelberger Massaker führen könnte.
Otokar Löbl beantragt eine Gedenktafel in Postelberg
Einen wichtigen Schritt in diese Richtung machte Herr Otokar Löbl, der Vorsitzende des „Fördervereins der Stadt Saaz“. Dies ist ein in der Bundesrepublik gegründeter Schwesterverein der rodáci unter dem Vorsitzenden Otokar Löbl, der sowohl deutsche als auch tschechische Mitglieder hat. In seiner Funktion als Vorsitzender des Vereins forderte Löbl im Dezember 2007 den Bürgermeister von Postelberg und den Postelberger Magistrat auf, im Sinne der Aufarbeitung der tschechischen Nachkriegsgeschichte für die Opfer des Postelberger Massakers ein Mahnmal mit einer Gedenktafel zu erstellen.
Der Magistrat der Stadt Postelberg war zunächst dagegen bzw. wollte nur einem Mahnmal mit Gedenktafel zustimmen, die der Opfer allgemein gedenkt – der Kriegsopfer, der tschechischen Opfer des Faschismus und auch der Opfer des Postelberger Massakers. Dem hat Herr Löbl nicht zugestimmt. Gegenüber der Saazer Zeitung „Denik Lucan“ sagte er am 26. August 2008, „dies erscheint mir wie ein Alibismus. In Saaz haben z. B. auch die Opfer im wolhynientschechischen Malin ein Denkmal [5]. Ich bin der Auffassung, dass auch die deutschen Opfer verdienen, geehrt zu werden“.
Der schwierigste Punkt der Verhandlungen mit dem Postelberger Magistrat bezog sich auf den Text des Mahnmals. Schließlich stimmte der Rat der Stadt einer sechsköpfigen Kommission zu, die auf der Sitzung der Postelberger Stadtverordnetenversammlung im 18. Februar dieses Jahres bestätigt wurde und die einen Vorschlag für einen Gedenkstein unterbreiten soll. Ihr gehören an: Jaroslav Vodicka für den Regionalverein der Wolhynientschechen, Michael Lichtenstein, der zweite Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Teplitz [6], Walter Urban, ein alteingesessener Postelberger [7], Petr Schöll, Mitglied des Finanzausschusses der Stadt Postelberg, Michal Pehr, ein Historiker und Vorsitzender der Christlich-Sozialen Partei in Laun, und Otokar Löbl. Die Kommission soll die Modalitäten ausarbeiten – wo das Denkmal stehen soll, wie es aussehen soll, die Inschrift der Gedenktafel und wie die Finanzierung erfolgen soll. Der Vorschlag der Kommission muss dann noch die Zustimmung im Stadtrat und der Stadtverordnetenversammlung finden. Die Kommission wird im Frühjahr dieses Jahres tagen.
Podiumsdiskussion in Prag
Im Rahmen der Wanderausstellung „Opfer der kommunistischen Macht in Nordböhmen in den Jahren 1945-1946 – War es gerechte Vergeltung, Rache oder ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit?“, die sich gerade in Prag befindet, gab es am 26. Februar 2009 eine Podiumsdiskussion in Novodvorská, einem Stadtteil in Prag. Zu dieser Veranstaltung, die als Informationsveranstaltung zu den Postelberger Geschehnissen gedacht war, lud Herr Löbl Bürger von Postelberg, das Stadtparlament und Mitglieder der Kommission ein, um ihnen die Möglichkeit zu eröffnen, sich in der Ausstellung und in der Podiumsdiskussion eingehend über die Postelberger Massaker zu informieren. In dieser Podiumsdiskussion schlugen die Emotionen hohe Wellen. Dies ergab sich auch daraus, dass zu der Podiumsdiskussion viele Kommunisten, angeführt von der Sprecherin des Zentralkomitees der tschechischen kommunistischen Partei, und Leute des extremen nationalistischen „Klubs des tschechischen Grenzgebietes“ gekommen waren.
Über die Podiumsdiskussion und die Ausstellung erschien in der „Mladá Fronta DNES“, der in der Tschechischen Republik meistgelesenen Zeitung, ein kurzer Artikel, den ich in deutscher Übersetzung anführe, um dem Leser einen Eindruck über den Verlauf der Podiumsdiskussion zu vermitteln:
Vertreibung oder Abschiebung (odsun)? Oder sollen wir heute Transfer sagen? Es schmerzt und brennt bis heute. Unerwartet hohe Emotionen rief eine Debatte über die Vertreibung, oder wenn sie so wollen, den „odsun“ der Sudetendeutschen hervor. Im Kulturzentrum Novodvorská wurde die Podiumsdiskussion von Otokar Löbl organisiert, der sich schon lange um eine Versöhnung zwischen Deutschen und Tschechen bemüht. Bei der Organisation der Podiumsdiskussion hat die „Mladá Fronta DNES“ geholfen. Ab und zu gab es Schreie aus dem Publikum, voller Emotionen, scharfe Wortgefechte – so als ob nicht schon sechzig Jahre seither vergangen wären. Die geladenen Gäste, die Historiker und Publizisten sprachen in versöhnlichem Geiste. Einer, der Schweizer Historiker Adrian von Arburg, appellierte an die Anwesenden: ‚Wir wollen uns vom Schachterldenken und von der Ideologie loslösen.‘ Seine tschechischen Kollegen, Michal Pehr und Vit Smetana wiesen darauf hin, dass die Vertreibung oder die Abschiebung (odsun) nur eine Reaktion darauf waren, wie sich die Sudetendeutschen vor dem Krieg benommen haben. Das entschuldigt aber nicht die Verbrechen, die nicht in Zweifel gezogen werden dürfen. Die Atmosphäre im Saal war dick. Ein Teil des Publikums wollte eine derartige Diskussion gar nicht zulassen: ‚Die Deutschen haben am Kriegsende in Prag hundert Menschen, Frauen und Kinder verbrannt‘, so argumentierte einer von ihnen. Ein weiterer erklärte, eine solche Debatte zu führen wäre schamlos in einem Prager Stadtteil, wo während des Krieges ein Fallbeil stand und viele unschuldige Leute starben. Die Atmosphäre war auch deshalb so schlecht, weil die Diskussion von einer provokativen Ausstellung begleitet wird, die von der Föderation unabhängiger Schriftsteller im Kulturzentrum veranstaltet wird. Sie versucht zu beweisen, dass die sogenannte Wilde Vertreibung, bei der Deutsche umgebracht und gefoltert worden waren, das planmäßige Werk der Kommunisten war. Damit waren die Historiker und die Publizisten und eine Reihe von Diskutierenden nicht ganz einverstanden: An den Verbrechen beim ‚Transfer‘ (ein neutrales Wort, das Vit Smetana vorschlug) hatten alle Bevölkerungsschichten einen Löwenanteil. Als eine Dame auf den antikommunistischen Charakter der Ausstellung hinwies, reagierte der Publizist Bohumil Doležal: ‚Aber ich bin ein Antikommunist – das darf man doch heute wohl sein! Und auch die übermäßig scharfe, persönliche Debatte, in der es aber keine Ohrfeigen gab, sondern nur Argumente, trägt dazu bei, dass man über alles reden darf.
Diese, vom Chefkommentator der „Mladá Fronta DNES“ Martin Komárek moderierte Podiumsdiskussion hat klar aufgezeigt, mit welchen Voreingenommenheiten, Aversionen und Hassäußerungen man sich auch heute immer noch bei dem Thema Aufarbeitung der Vergangenheit in der Tschechischen Republik auseinandersetzen muss. Die Kommission, die einen Vorschlag für ein Mahnmal in Postelberg erarbeiten soll, wird es nicht leicht haben. Es ist zu hoffen, dass es trotzdem ein Mahnmal für die Opfer des Postelberger Massakers geben wird und vor allem, dass es eine dem Gedenken würdige und der Wahrheit entsprechende Inschrift tragen wird, die den Opfern gerecht wird, und keine nichtssagende Formulierung.
Zur Ausstellung „Opfer der kommunistischen Macht“
Um nochmals auf die Ausstellung zurückzukommen. Sie hat sicherlich dazu beigetragen, dass viele, vor allem auch junge Tschechen, von den an Sudetendeutschen in Postelberg verübten Massenmorden Kenntnis erlangt haben, und dass der tschechischen Bevölkerung nach vielen Jahren kommunistischer Indoktrination neue Erkenntnisse über die Vertreibung gegen bisher festgefressene Klischees vermittelt wurden. Es ist leicht einzusehen, dass es sich für manche Tschechen dabei um einen schmerzlichen Erkenntnisprozess handelt. Die Ausstellung ist objektiv und entspricht den Tatsachen. Sie zeigt auf, dass die Kommunisten einen Löwenanteil der Schuld an den in Postelberg verübten Massakern tragen. Die Massenmorde waren, wie die Ausstellung dokumentierte, nicht eine Explosion des Volkszorns, sondern ein Akt der Staatsmacht. Sie wurden vom tschechoslowakischen Militär geplant, organisiert und von Einheiten der Svoboda-Armee durchgeführt. Die Svoboda-Armee, die der Kommunist General Svoboda befehligte [9], wurde nach Einnahme von Wolhynien [in der Ukraine] durch die Sowjetarmee zusammengestellt. Einer der Haupträdelsführer bei den Massenmorden in Postelberg, Oberleutnant Zícha (Deckname Petrov) wurde später Vorsitzender des Kreisnationalausschusses (Okresni národni vybor [wörtlich „Bezirksnationalausschusses“]) in Saaz und war Kreisvorsitzender der kommunistischen Partei in Saaz.
Die Täter waren allerdings nicht nur die Kommunisten. Sie hatten willige Helfer, vor allem extrem nationalistisch geprägte Tschechen, z. B . im Okresni národni vybor (Nationalausschuss) in Saaz. Dessen seinerzeitiger Vorsitzende Dr. Petraček war kein Kommunist und er war am Organisieren des Todesmarsches der Saazer Männer nach Postelberg maßgebend beteiligt gewesen. Eine entscheidende Rolle spielte schließlich auch die Habgier nach deutschem Eigentum und auch bei manchen Tschechen der Umstand, dass sie durch Dienste für die Nazis Dreck am Stecken hatten und sich durch übereifrigen „Patriotismus“ reinwaschen wollten.
Letztendlich war auch das Postelberger Massaker eingebettet in den Ablauf und in den Rahmen der Vertreibung der Sudetendeutschen, und [waren] die Massenmorde nur möglich, weil die Beneš-Dekrete die entsprechenden Rahmenbedingungen herstellten: durch Enteignung der Deutschen, deren Kennzeichnung [durch Armbinden], deren Einsatz zur Zwangsarbeit und Einweisung in Lager und nachträglich auch noch durch Legalisierung der an Deutschen nach Kriegsende begangenen Verbrechen. Schließlich hatten auch die Teilnehmer der Diskussionsrunde recht, welche behaupteten, dass an den an Sudetendeutschen verübten Verbrechen alle tschechischen Bevölkerungsschichten einen Anteil hatten: alle nach Kriegsende zugelassenen tschechischen Parteien haben im Kaschauer Programm der Vertreibung zugestimmt. Und die Vertreibung von Millionen von Menschen ist eines der größten Verbrechen des 20. Jahrhunderts.
Anmerkungen der Redaktion:
[1] Unter „Todesmarsch“ versteht man Märsche von Gefangenen von einem Lager zum anderen, die ohne Rücksicht auf die Gesundheit und ohne Verpflegung der Häftlinge über eine große Entfernung durchgeführt wurden, wobei der Tod der Häftlinge nicht nur in Kauf genommen, sondern durch Erschießung von schwachen und kranken Teilnehmern absichtlich herbeigeführt wird. Postelberg liegt 15 Kilometer von Saaz entfernt. Tatsächlich kamen auf dem Hin- und Rückweg einige Häftlinge zu Tode. Auch sind hunderte von ihnen tatsächlich insofern „in den Tod marschiert“, als sie in Postelberg ermordet wurden. Trotzdem ist dieser Marsch nicht mit den bekannten Todesmärschen, etwa dem von Brünn vergleichbar, erst recht nicht mit den Todesmärschen aus KZs , die den Tod der Marschierenden regelrecht zum Ziel hatten.Kranzniederlegung zur „Reichskristallnacht“ in Saaz
Tschechen und Deutsche gedenken der Leiden ihrer jüdischen Mitbürger
Tschechen und Deutsche trafen sich am Montag, den 10. November 2008 in Saaz|Žatec zu einem Gedenkakt an der Synagoge, die vor 70 Jahren in der sogenannten „Reichskristallnacht“ gebrandschatzt wurde. An der Feierlichkeit beteiligten sich Vertreter und Mitglieder der jüdischen Gemeinde Teplitz sowie städtische und staatliche Repräsentanten. In Saaz gibt es seit der Nazizeit keine jüdische Gemeinde mehr. Die Synagoge, die in kommunistischer Zeit als Lagerhalle diente, ist heute äußerlich renoviert, die Innenräume warten indes noch auf eine Wiederherstellung und angemessene Nutzung.
 Vertreter des deutschen „Fördervereins der Stadt Saaz|Žatec“ und des „Heimatkreises Saaz“ sowie des tschechischen Vereins der „Landsleute und Freunde der Stadt Žatec“ legten am Haupteingang der Synagoge einen Kranz nieder. Ein jüdischer Geistlicher trug Verse aus den Alten Testament in Tschechisch und Hebräisch vor, der Kinderchor „Poupata“ sang jüdische und tschechische Lieder. Anschließend traf man sich im Saazer Rathaus, wo die Kinder ihre Aufführung fortsetzten. In Ansprachen wurde an in die schrecklichen Ereignisse während Nazi-Okkupation erinnert.
Vertreter des deutschen „Fördervereins der Stadt Saaz|Žatec“ und des „Heimatkreises Saaz“ sowie des tschechischen Vereins der „Landsleute und Freunde der Stadt Žatec“ legten am Haupteingang der Synagoge einen Kranz nieder. Ein jüdischer Geistlicher trug Verse aus den Alten Testament in Tschechisch und Hebräisch vor, der Kinderchor „Poupata“ sang jüdische und tschechische Lieder. Anschließend traf man sich im Saazer Rathaus, wo die Kinder ihre Aufführung fortsetzten. In Ansprachen wurde an in die schrecklichen Ereignisse während Nazi-Okkupation erinnert.
Der Vorsitzende des „Fördervereins“, Otokar Löbl, hob gegenüber der Presse den kulturellen Verlust hervor, den Saaz durch die Vernichtung der Juden und ihrer Gemeinde erlitten habe. Überlebende, die später zurückkehren wollten, seien wegen ihrer deutschen Sprache unerwünscht und wie alle Deutschen von Enteignungen betroffen gewesen. In der tschechischen Presse fand das Ereignis große Aufmerksamkeit. Anwesend waren neben Vertretern der Saazer Presse Redakteure der Zeitungen Svobodny Hlas (Louny), MF Idnes, Blesk, Pravo sowie Vertreter der Presseagentur CTK und des nordböhmischen Rundfunks.
An dem Gedenken beteiligten sich namentlich der Bürgermeister von Saaz, Erich Knoblauch, der Senator der Tschechischen Republik, Marcel Chládek, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Teplitz, Oldrich Latal, sowie als weiteres Vorstandsmitglied Herr Loblowitz, der Vorsitzende des „Fördervereins der Stadt Saaz|Žatec“, Otokar Löbl, das Vorstandsmitglied des „Heimatkreises Saaz“, Helmut Wabra, das Mitglied des „Freundeskreises Deutsch-tschechischer Verständigung“, Bohuslav Řeřicha, der Vorsitzende des tschechischen „Vereins der Landsleute und Freunde der Stadt Žatec“, Petr Šimácek, und für die Wolynientschechen und den Verband der Freiheitskämpfer, Jaroslav Vodicka, außerdem weitere Mitglieder der genannten Vereine sowie Gäste.
- Gäste der Veranstaltung
- Löbl und Šimáček
- Auf den Weg zu der Synagoge
- Senator der ČR Marcel Chládek
- Der Direktor des Stadtmuseums Kopica
- Bürgermeister der Stadt Saaz Knoblauch
- Oldřich Látal, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Teplice























